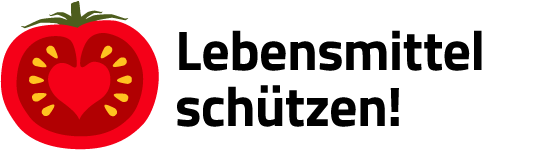Häufige Fragen & ihre Antworten
-
Die Gentechnik birgt grosse Risiken für die menschliche Gesundheit, das Tierwohl, den Umweltschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Viele dieser Risiken sind noch nicht einmal ausreichend erforscht. Nicht auszudenken, welche Langzeitfolgen die unkontrollierte Verbreitung von gentechnisch veränderten Pflanzen oder die durch den Konsum von Gentechnik-Lebensmittel entstehenden gesundheitlichen Probleme in Zukunft haben könnten. Im Sinne des Vorsorgeprinzips braucht es deshalb klare Regeln und eine umfassende Risikoprüfung.
-
Im Sinne der Transparenz und Fairness müssen Gentechnik-Lebensmittel gekennzeichnet werden. Passiert das nicht, verlieren die Konsument:innen ihre Wahlfreiheit, was wiederum den Konsumentenschutz missachtet. Die Lebensmittelschutz-Initiative stellt die Kennzeichnung vom Acker bis zum Teller sicher. Täuschungsmanöver wie die Bezeichnung «neuen» Züchtungstechnologien führen die Bevölkerung mutwillig hinters Licht. Denn wo Gentechnik drin ist, muss auch Gentechnik draufstehen.
-
Wird Gentechnik zugelassen, können sich diese Organismen z.B. durch den Pollenflug verbreiten und gentechnikfreie Felder verunreinigen. Diese Verunreinigungen sind nicht rückgängig zu machen. Ohne klare Regeln zum Schutz der gentechnikfreien Landwirtschaft, droht ein riesiger wirtschaftlicher und ökologischer Schaden. Auch gilt es die Autonomie der Bäuerinnen und Bauern zu bewahren, die sowieso bereits immer stärker zum Spielball der Grossverteiler und Industrie werden und Konflikten zwischen benachbarten Betrieben vorzubeugen.
-
Die Schweiz ist gentechnikfrei und dafür weit bekannt. Schweizer Produkte zeichnen sich durch ihre Gentechnikfreiheit aus und können für den Export mit entsprechenden Gütesiegeln versehen werden. Labels wie «Suisse Garantie», «IP Suisse», «Bio Suisse» oder «Demeter» schreiben dies auch in ihren Richtlinien so vor. Bei den Qualitätsauszeichnungen «AOP/IGP» ist durch die traditionelle und ursprüngliche Herstellung selbsterklärend gegeben, dass die Produkte gentechfrei sind. Ohne dieses Alleinstellungsmerkmal drohen dem inländischen Absatz- aber auch dem Exportmarkt grosse wirtschaftliche Einbusse.
-
Die herkömmliche Gentechnik wird von der Schweizer Bevölkerung grossmehrheitlich abgelehnt. Eine neue Umfrage des führenden Meinungsforschungsinstituts Sotomo aus dem Jahr 2025 zeigt, dass die Schweizer:innen auch die sogenannte «neue» Gentechnik mehrheitlich ablehnen und im Falle einer Zulassung strenge Regulierungen fordern. Mehr als drei von vier Personen wollen eine Kennzeichnungspflicht, eine umfassende Risikoprüfung und Massnahmen zum Erhalt der gentechnikfreien Produktion.
-
Die kurze Antwort ist: Nein. Keine der bisher auf den Markt gebrachten oder sich in der Entwicklung befindenden Gentechnik-Pflanzen bringt einen ökologischen Mehrwert, wie eine neue Analyse aus dem Jahr 2025 zeigt. Meist führen diese Pflanzen im Anbau sogar zu einem noch höheren Einsatz an Pestiziden und Dünger (bspw. in den USA ersichtlich), was Böden und Klima weiter zerstört.
-
Auch bei der sogenannten «neuen» Gentechnik wird tief ins Genom eines Organismus eingegriffen. Die Folgen davon sind schwer abzuschätzen und unzureichend erforscht. Auch wenn die Agrochemie-Konzerne gerne das Gegenteil behaupten: Aus wissenschaftlicher Sicht ist es klar, dass es sich bei CRISPR/Cas, der sogenannten «neuen» Gentechnik, um eine gentechnische Veränderung handelt. Durch solch tiefe Eingriffe des Menschen in den Zellkern eines Organismus ist es nicht abzuschätzen, welche unbeabsichtigten Nebeneffekte entstehen können. Auch die Rechtssprechung sagt klipp und klar, dass es sich bei diesen Verfahren nach wie vor um Gentechnik handelt.
-
Auch wenn das Moratorium kürzlich um weitere fünf Jahre verlängert wurde, droht die sogenannte «neue» Gentechnik durch die Hintertür eingeführt zu werden. Die Gentechnik-Lobby wirkt darauf hin, dass das Moratorium mit einem Spezialgesetz umgangen wird. Deswegen braucht es zwingend die Lebensmittelschutz-Initiative, um zu verhindern, dass Gentechnik durch die Hintertür auf die Schweizer Äckern und Teller gelangt.
-
Klar, da gentechnische Eingriffe bei Tieren im Ausland schon jetzt gemacht werden. Mit gentechnischen Verfahren können Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen verändert werden. Auch wenn heute in Bezug auf die «neue» Gentechnik primär über die Entwicklung von Pflanzensorten gesprochen wird, wird schon an Gentechnik-Tieren gearbeitet. Ein Beispiel dafür sind “Doppelmuskeltiere”, bei welchen muskelwachstumshemmende Gene ausgeschaltet werden. Das Produkt sind regelrechte Bodybuilder-Tiere, die unter der Last ihrer eigenen Muskeln fast zusammenbrechen.
-
Gentechnische Verfahren ermöglichen es den Agrochemie-Konzernen Patente auf Saatgut zu erheben. Die Konzerne entwickeln Sorten, um an deren Lizenzgebühren zu verdienen und sich Einfluss zu verschaffen. Erstrecken sich Patente auch auf Pflanzen aus herkömmlicher Züchtung, werden Bäuer:innen noch abhängiger von den Agrarmultis. Dass durch die «neue» Gentechnik auch bereits bestehende Charaktereigenschaften von Pflanzen aus herkömmlicher Züchtung nachgebaut und allgemein patentiert werden, ist zu verhindern. Schon heute kontrolliert eine Handvoll Konzerne zwei Drittel des weltweiten Saatguts. Dieser Monopolisierung und Privatisierung der natürlichen genetischen Vielfalt gilt es, den Riegel vorzuschieben.